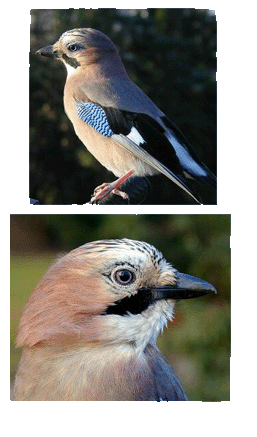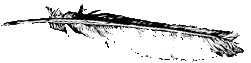- Allgemeines: Als Angehöriger der Familie der Rabenvögel ist der Eichelhäher sehr intelligent und anpassungsfähig.
-
- Vorkommen: Der Eichelhäher fehlt in Mitteleuropa nur in den waldfreien Gebieten. Besiedelt werden sowohl Laub- und Misch- als auch Nadelwälder. In jüngster Zeit siedelte ist er auch in den Parks, Grünanlagen und großen Gärten der Städte zu finden.
-
- In Gebirgslagen besiedelt er diese bis in ca. 1.600 m. Der Häher ist nur in bewaldeten Gebieten häufig, da die einzelnen Brutpaare große Reviere verteidigen und gegeneinander meist unverträglich sind.
-
- Im Wienerwald ist er Standvogel, der in manchen Wintern Gesellschaft von Artgenossen aus dem Norden und Osten bekommt. In strengen Wintern bekommt der Eichelhäher auch Gesellschaft vom Tannenhäher Nucifraga caryocatactes.
-
- Nahrung: Der Speisezettel des Eichelhähers ist wie bei allen Rabenvögeln vielseitig. Es überwiegt pflanzliche Nahrung, sie besteht aus vielerlei Früchten und Samen, wie z.B. Eicheln, Bucheckern, Haselnüssen, Bohnen, Erbsen, Mais, Kirschen und Beeren.
-
- Aber auch tierische Kost - kleine Mäuse, Spitzmäuse, Reptilien, Eier, Jungvögel sowie Insekten - zählt dazu.
-
- Das ihm zur Last gelegte Plündern von Singvogelnestern ist keine Ausnahme, rechtfertigt allerdings keine Verfolgung des Vogels.
-
- Einzelne Vögel können sich allerdings z.B. auf das Ausräumen von Nestern spezialisieren.
-
- Brutbiologie: Die streng monogam lebenden Vögel bauen ihr Nest in Astgabeln von Bäumen und Büschen zwischen 2,0 und 5,0 m Höhe. Dichter Wald oder Feldgehölze werden als Standort bevorzugt. Ausnahmsweise erfolgt die Brut auch in Nischen von Gebäuden und in verlassenen Spechthöhlen.
-
- Das Nest besteht aus Reisern, die mit Wurzeln, Pflanzenbast, Tierhaaren u.a. ausgepolstert werden.
-
- In der Brutzeit, von Ende April bis Anfang Mai, sind die Vögel sehr heimlich. Das Legen der graugrünen bis bräunlichen gefleckten Eier erfolgt erst, wenn das Laub des Brutbaumes genügend Deckung bietet.
-
- Das allein brütenden Weibchen, brütet 4 bis 7 Eier 16 bis 19 Tagen aus und wird während dieser Zeit vom Männchen aus dem Kropf gefüttert.
-
- Nach weiteren 23 Tagen fliegen die Jungen aus. In der Nestlingzeit werden sie vor allem mit tierischer Kost, Spinnen sowie wirbellosen Kleintieren, Eiern und Jungvögeln versorgt.
-
- Die Jungen werden erst nach ca. 8 Wochen selbständig. Normalerweise erfolgt nur eine Brut pro Jahr, allerdinhs bei Verlust der Brut sind Ersatzgelege möglich.
-
- Ca. 50 % der Bruten kommen um. Zu den Hauptfeinden, die Eier rauben bzw. die ausgeflogenen Jungen erbeuten, gehören Marder, Eichhörnchen, Elstern, Krähen sowie Habicht, Sperber und Äskulapnatter.
-
- Lautäußerungen: Der leise plaudernde Gesang ist mit vielen glucksenden, krächzenden und auch miauenden Rufen durchsetzt.
-
- Dabei ist der Eichelhäher ein ausgezeichneter Stimmenimitator. Er kann z. B. das „Hiäh" des Bussards, Kauz- und Krähenrufe, das Fiepen des Rehs, Hunde, Ziegen sowie das Knarren von Ästen täuschend ähnlich nachahmen.
-
- Sein markantes heiseres Rätschen wie oder das jede Bewegung im Wald meldet, warnt das scheue Wild vor Gefahr.
-
- Dieses Verhalten verhalf ihm auch die Spitznamen Markwart bzw. Holzschreier ein.
-
- Aber auch seine Feinde Habicht, Sperber, Marder und Uhu sowie auch andere Beutegreifer wie der Fuchs bzw. andere Rabenvögel werden vom „Waldpolizisten" lautstark vermeldet.
-
- Lebensweise: Jeder Eichelhäher sammelt im Herbst einen Vorrat an Eicheln, Bucheckern, Haselnüssen und auch Ähren. Innerhalb kurzer Zeit verschlingt er bis zu 12 Eicheln, die sich in seinem Kropf ansammeln. Diese versteckt er, nachdem er die Eicheln aus dem Kropf wieder hervorgewürgt hat.
-
- Dafür sucht er trockene an Randlagen aus, an denen sich der Schnee nicht zu lange hält. Hier vergräbt er die Beute - in der Regel einzeln. Noch nach Monaten kann er sich anhand der Geländestruktur an einige der Verstecke erinnern. Aus den vergessenen Verstecken treiben junge Eichen aus. das verjüngt den Wald auf natürliche Art und Weise dort, wo er sich von allein nie aussäen könnte.
-
- Nach Berechnungen können bis zu 5000 Eichensämlinge / jährlich auf diese Art und Weise keimen, das entspricht ca. einem ha Hähersaat-Baumkultur.
-

|